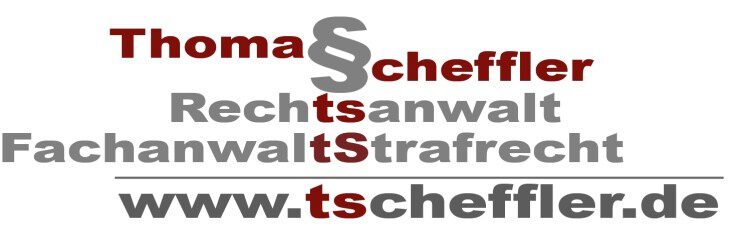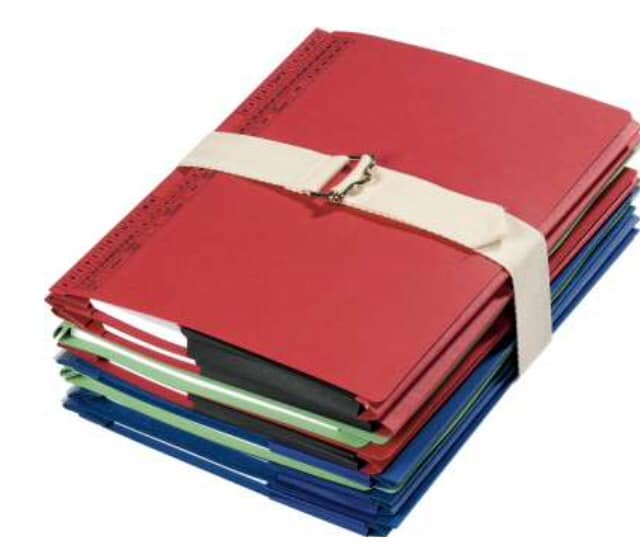Fehlurteil
Das Fehlurteil ist die hässlichste Fratze, die ein Rechtsstaat seinen Untertanen zeigen kann. In meinem Roman „Rheingold! Reines Gold“ habe ich die Entstehung eines der schockierendsten Fehlurteile in der jüngeren deutschen Rechtsgeschichte – mit einem Schuss dichterischer Freiheit – kurz nacherzählt.
»Im Oktober des Jahres 2001 verschwand der Bauer Rudolf Rupp spurlos von einem bayerischen Bauernhof. Seine Familie – eine Frau und zwei Töchte -, bestand, so wird berichtet, nicht unbedingt aus Geistesgrößen. Es soll sich um eher einfach strukturierte Personen gehandelt haben. Ehefrau und Töchter, seiner täglichen Misshandlungen schon lange überdrüssig, waren über das Ausbleiben des Bauern nicht sonderlich traurig. Ganz anders die Polizei.
Ein Vermisstenfall ist eine Akte, plötzliches Verschwinden aber kein ausreichender Grund, die Akte zu schließen. Da Beamte es einfach nicht mögen, wenn eine Akte nicht ordentlich abgeschlossen wird, musste eine Erklärung her.
Nun sind Polizisten auch nicht schlauer als der Durchschnittsbürger. Wie sollten sie auch, sie sind ja Durchschnittsbürger. Folglich konnten sie das Rätsel um den Verbleib des Bauers Rupp ebenso wenig lösen wie jedermann. Allerdings beherrschen Kriminalisten eine Kunst, der Normalbürger schon deshalb nicht frönen, weil sie nicht wirklich weiterhilft. Wo immer unsere Ordnungshüter an die Grenze ihrer reduzierten Inspiration gelangen, bilden sie nämlich kriminalistische Hypothesen.
Die kriminalistische Hypothese ist die Basis vieler Strafverfahren, insbesondere der ungeklärten. Eine kriminalistische Hypothese ist nicht mehr als eine Theorie, wie etwas gewesen sein könnte. Ein während einer Kaffeerunde entworfenes Konstrukt, eine hoheitliche Märchenstunde, ein Pfeilwurf auf die Dartscheibe aller denkbaren Möglichkeiten. Kriminalistisch hypothetisch ist der Punkt unter Tausenden, den der Pfeil trifft.
Wenn der Kaffee dann erkaltet oder die Dartrunde beendet ist, geschehen auf deutschen Polizeistationen seltsame Dinge. Die vorher noch so drängende Frage nach der Wahrheit wird jetzt hektisch in den Müll gestampft. An ihre Stelle tritt die kriminalistische Hypothese als künftig alleingültige Wirklichkeit. Von Belang sind fortan ausschließlich solche Beweise, welche die Hypothese stützen. Zweifel oder kritische Fragen gelten als tabu.
Im Falle des Bauern Rupp war die kriminalistische Hypothese bald gestrickt und lautete folgendermaßen: Ehefrau und Tochter haben den Bauern ermordet, zerstückelt und dann an die Hunde auf dem Hof verfüttert.
Der Vorteil dieser Hypothese liegt auf der Hand. Nicht nur das Verschwinden des Bauern ließ sich so aufklären. Es gab obendrein auch gleich noch eine plausible Erklärung dafür, warum der Bauer keine Spuren hinterlassen hatte. Zusätzlich lieferte die Theorie sogar Täter, die für die Tat verurteilt werden konnten. Alle Probleme der lästigen Vermisstenakte schienen im Handumdrehen gelöst.
Die Kriminalbeamten dürften ordentlich gefeiert haben. Wieder und wieder diskutierten sie ihre kriminalistische Hypothese. Keiner fand einen Fehler. Bis einem auffiel, dass eine Tochter des Bauern Rupp bereits verlobt war. Schlagartig rutschte die Stimmung in den Keller. Das konnte gefährlich werden.
Verlobte müssen nicht aussagen. Man konnte den Mann also nicht vor dem Prozess durch die Mangel drehen. Sie können jedoch aussagen, wenn sie wollen. Was dies bedeutete, war den erfahrenen Kriminalisten umgehend klar. Verlobte sagen immer nur zugunsten der möglichen Täter aus, wobei sie sich meistens als Alibizeuge anbieten. Die Stimmung auf der Wache wurde immer deprimierter. Einen Alibizeugen konnte man nicht gebrauchen.
Wahrscheinlich war es der Älteste unter den Polizisten oder der Erfahrenste, auf jeden Fall einer, der sich schon in manchem ungeklärtem Fall bewährt hatte. Dem kam der rettende Gedanke.
»Wisst ihr was, Leute? Wir beschuldigen den Verlobten einfach mit. Wenn er an der Tat beteiligt war, dann kann er kein Zeuge sein, schon gar kein Alibizeuge.«
Gesagt, getan. Die kriminalistische Hypothese wurde leicht modifiziert, dann ging es an die Beweisführung.
Minderbemittelte Beschuldigte sind keine wirklichen Gegner für die Ermittler eines Morddezernats. Sie lassen sich durch entsprechenden psychischen Druck beliebig biegen. Es bedurfte nur eines ausgedehnten Dauerverhörs, geringfügigen Schlafentzugs, sanfter Brüllerei im Verhörzimmer. All die Methoden, von denen die Kriminalpolizei ständig behauptet, es gäbe sie gar nicht. Am Ende unterschrieben alle das Geständnis.
Ein Zeuge beschwerte sich hinterher, man habe ihn mit der Pistole an der Schläfe zur Aussage gezwungen. Sogar an den genauen Wortlaut konnte er sich erinnern: »Es geht schließlich um Mord, da dürfen wir alles.«
Wer nun denkt, die Staatsanwaltschaft habe nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe gegen den Polizisten ermittelt, hat immer noch nicht verstanden, wie so etwas hierzulande läuft. Selbstverständlich wurde der Zeuge angeklagt, und zwar wegen einer angeblichen Falschaussage.
Aber zurück zum Fall des Bauern Rupp: Die Anklage wegen Totschlags war nach derartigen Geständnissen reine Routine. Verteidiger warteten zwar im Prozess noch mit dem Widerruf der Geständnisse auf, aber die zuständige Staatsanwaltschaft blieb unbeirrbar. Schließlich hatte die Polizei eine kriminalistische Hypothese gebildet. Diese war durch die Vernehmungen in allen Punkten bestätigt worden. Wer sollte da noch Zweifel hegen?
Gott sei Dank gibt es auch in Bayern noch unabhängige Richter, denen die These vom Zerstückeln des Bauern Rupp eher seltsam vorkam. Wieso hatten denn nirgendwo Spuren eines solchen Gemetzels gesichert werden können. Und wo war das Auto des Bauern, immerhin ein Mercedes? Den konnten doch nicht auch noch die Hunde gefressen haben.
Das Gericht war aufrichtig bemüht, die Lücke in der Beweiskette persönlich zu schließen. Schon nach kurzer Beratung gelang das ewige Werk: Bauer Rupp wurde eben nicht nur an Hunde verfüttert, die zumindest Knochen übrig gelassen hätten, sondern auch an die Schweine des Hofes. Dies erkläre das Fehlen jeglicher Spuren. Und was das verschwundene Auto betraf, so lässt sich ein bayerischer Richter dadurch nicht aus dem Konzept bringen. Der Mercedes wurde in einer Schrottpresse beseitigt, befand die Strafkammer. Gerade so, als habe jeder eine Schrottpresse zu Hause. Einen ganzen Mercedes verdauen die locker.
Der Vorsitzende fand in seiner Urteilsbegründung dramatische Worte, faselte von einer »schrecklichen Tat«, die er glücklicherweise habe aufklären können. Für ihn ergab sich „ein deutliches und im Wesentlichen übereinstimmendes Bild, so dass an der Wahrheit nicht zu zweifeln ist.“ Die widerrufenen Geständnisse der Angeklagten beirrten ihn mitnichten, denn »dass die grausigen Schilderungen nur ausgedacht worden seien, kann wohl niemand ernsthaft glauben“. Also sprach Justitia und nahm Ehefrau nebst Verlobtem der Tochter für lange Jahre barmherzig in ihre Haftanstalten auf. Die Töchter selbst wurden zu Jugendstrafen verurteilt. Die ganze Brut verschwand hinter Gittern.
Im März 2009 wurde in der Nähe des Bauernhofes Rupp ein Stausee abgelassen. Auf dem Grund des Sees fanden Ermittler den Mercedes des Bauern Rupp mitsamt seiner skelettierten Leiche. Die Mär vom Verfüttern an Hunde oder Schweine war widerlegt.
Die Todesursache konnte nach Jahren im Wasser nicht sicher bestimmt werden. Zumindest hatte aber niemand dem Bauern seinen Schädel eingeschlagen, was das Gericht im Prozess gegen die Angehörigen doch gerade zweifelsfrei festgestellt haben wollte. Nun hatte die Justiz ein Problem.
Ein Skelett, das im Wasser liegt, kann nicht von Schweinen auf dem Hof gefressen worden sein, würde Otto Normalverbraucher behaupten. Nicht anders dachte ein mutiger Strafverteidiger, der umgehend die Wiederaufnahme des Strafverfahrens beantragte. Doch so einfach verzichtet der Staat nicht auf den Rechtsfrieden, den er mit seinen Urteilen angeblich herstellt.
»Es ziemt dem Untertanen nicht, an die Handlungen des Staatsoberhaupts den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen«, hatte der preußische Minister Gustav von Rochow im Jahre 1838 dem Volke diktiert. Staatsanwaltschaft und Landgericht in Landshut müssen diesen Erlass gekannt haben. Mit vereinten Kräften wiesen sie den Wiederaufnahmeantrag ab und gaben dem Verteidiger schriftlich, wie das seit langem rechtskräftige Urteil zu verstehen sei: Die Ehefrau und der Verlobte der Tochter wurden deshalb verurteilt, weil sie den Bauern Rupp umgebracht haben. Zweifel an dieser Erkenntnis seien nicht angebracht, denn das Skelett im See beweise doch eindeutig, dass Bauer Rupp nicht mehr unter den Lebenden weile. Ob er zusätzlich auch noch an Hunde oder gar Schweine verfüttert wurde, sei völlig egal. Denn auch ein ertrunkener Bauer sei ein toter Bauer. Dafür müssten die Verurteilten sitzen. Es gebe daher, so das Landgericht Landshut mit messerscharfer juristischer Logik, überhaupt keinen Grund, ein rechtskräftiges Urteil anzuzweifeln. Wiederaufnahme abgelehnt.
Letztlich verhalf die zweite Instanz dem so gescholtenen Verteidiger glücklicherweise dennoch zu einem Wiederaufnahmeverfahren. Bis Ehefrau und Verlobter der Tochter aber endlich freigesprochen waren, hatten sie ihre zu Unrecht verhängte Haftstrafe längst abgesessen. Die Töchter waren nach Verbüßung ihrer etwas kürzeren Jugendstrafen ohnehin schon wieder auf freiem Fuß.“