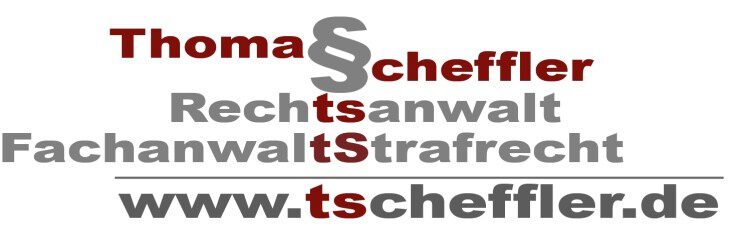Was ist eigentlich eine „Eilanordnungskompetenz“?
Morgens halb zehn in Deutschland: Die Bauarbeiter der Nation kauen gerade Nussriegel, die Richter sitzen in der Kantine und trinken Kaffee. Alles ruht, einer wacht: der Staatsanwalt! Ebenfalls immer im Dienst ist die Polizei, die soeben einen ganz heißen Tipp bekommen hat. Daniel Düsentrieb hortet in seiner Wohnung Drogen! Schnell ein Anruf beim Staatsanwalt: Dürfen wir rein?
Der Staatsanwalt kämpft sich durch eine äußerst komplizierte Rechtslage, denn die Antwort auf das Anliegen der Polizei liegt in zwei Gesetzen verstreut. Da wäre zunächst das Grundgesetz mit der klaren Ansage „Die Wohnung ist unverletzlich.“ Daneben gibt es eine Strafprozessordnung, die vorschreibt, dass Wohnungsdurchsuchungen nur durch einen Richter angeordnet werden dürfen. Allerdings, so steht da weiter, darf die Anordnung bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwalt treffen. Was nun? Liegt hier Gefahr im Verzug vor, nur weil der Richter gerade Kaffee trinkt? Oder braucht es dazu mehr, vielleicht den Totalausfall aller Richter, den Stillstand der Rechtspflege, die Stunde Null des Rechtsstaates?
In der Praxis besteht Gefahr im Verzug regelmäßig samstagnachts um drei. Denn das Böse schläft nie, Richter schon. Darum ist irgendwo im Land immer ein Staatsanwalt wach. Nicht weil er böse wäre, sondern weil die Jagd nach Verbrechern sein Lebenszweck ist. Der Blick auf die Uhr zeigt jedoch: Es ist jetzt erst dreiviertel zehn an einem gewöhnlichen Werktag. Noch ziemlich lange hin bis samstagnachts. Was mach´ ich nur, was mach´ ich nur?
Rückfrage an den Außendienst: Wie sieht’s aus vor Ort? Die Antwort jagt den Puls nach oben: Polizeimeister Bullerich hat gerade dezent an der Tür gelauscht, die dabei die wie von Wunderhand einfach aufgesprungen ist. Wir blicken auf ein ganzes Arsenal von Drogen, Waffen und Falschgeld. Dürfen wir jetzt endlich rein?
Und in diesem Augenblick tut der Staatsanwalt Daniel Düsentrieb einen sehr großen Gefallen: „Hebt die Bude aus!“ spricht er in das Telefon. Den Rest des Tages verbringt die Polizei mit dem Katalogisieren einer LKW-Ladung voller Asservate, so nennen sie das, was sie jetzt aus Daniel Düsentriebs Wohnung abtransportieren.
Machen wir uns nichts vor: Hätte der Staatsanwalt diesen Sachverhalt einem Ermittlungsrichter geschildert, wäre die Durchsuchungsanordnung postwendend ergangen, ohne dass jener sich beim Kaffeetrinken hätte stören lassen. Das ist der Grund, warum die selbsternannten Verfechter des Rechtsstaates nun aufheulen. Alles nicht so schlimm! Was soll der Quatsch? Bloße Förmelei! Und während Daniel Düsentrieb (er ist wohl mittlerweile an seiner Wohnung aufgetaucht) bereits in Handschellen zu Gericht transportiert wird, die Anordnung der Untersuchungshaft nur noch eines kurzen Termins beim Haftrichter bedarf (auch so eine unnütze Förmelei?), lese ich nochmal kurz bei Rudolf von Ihering nach. Der war ein ziemlich bedeutender Rechtswissenschaftler des vorletzten Jahrhunderts und ziemlich überzeugt davon, „dass wir in der Form die geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der Freiheit haben“.
Für Daniel Düsentrieb bedeutet dieser Satz an diesem Tag tatsächlich Freiheit, auch wenn Du, geneigter Leser, nun ungläubig staunen wirst. Denn der Staatsanwalt hat einen entscheidenden Fehler begangen. Er hätte die Polizei anweisen müssen, die Wohnung so lange zu bewachen, bis die Kaffeepause des Richters beendet und dieser bereit zu einer Entscheidung ist. Niemals aber hätte er selbst die Durchsuchung anordnen dürfen, denn er hatte keine Eilanordnungskompetenz, jedenfalls nicht morgens um halb zehn in Deutschland.
In Karlsruhe, dort wo unsere höchsten Strafrichter sitzen, sieht man diese Eigenmächtigkeiten sehr ungern. Zwar würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der LKW voller Asservate tatsächlich einem Beweisverwertungsverbot unterliegt, aber zumindest beim Haftrichter findet der Staatsanwalt keine Gnade. Denn durch die grobe Missachtung des Richtervorbehalts wurden wesentliche Sicherungsmechanismen des Rechtsstaates umgangen und Beweise durch bewussten Rechtsbruch erlangt.
Darum pfeift sich Daniel Düsentrieb jetzt etwas zur Erholung rein und Polizeimeister Bullerich wird künftig mitteilen, dass es sich beim Lauschen so anhöre, als würde da gerade jemand Drogen in der Klospülung versenken. Das könnte die Gefahr in Verzig begründen, nützen wird ihm das aber nicht, denn der Staatsanwalt wird künftig lieber den Telefonhörer abhängen und sich einen Müsliriegel gönnen, morgens um halb zehn in Deutschland.
Nachtrag:
Ganz kampflos hat die Staatsanwaltschaft das nicht hingenommen. Nach einer Beschwerde wurde Daniel Düsentrieb vom Landgericht wieder in U-Haft geschickt. Meine weitere Beschwerde hat dann aber beim OLG Koblenz Gehör gefunden. Die Untersuchungshaft wurde aufgehoben. Und weil´s so schön ist, veröffentliche ich den Beschluss hier mal.