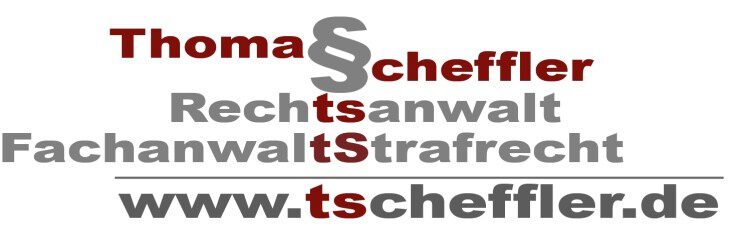Wie weit geht eigentlich die „richterliche Unabhängigkeit“?
Das Netz ist voll von skurrilen Urteilen. Ich erwähne hier nur mal zwei herausragende Beispiele (mit Quellenangabe, falls es jemand nicht glauben will):
1.) Das Landgericht Stuttgart hat einst verlauten lassen, was es von der Urteilsfindung in oberen und höchsten Gerichten hält:
»Die entsprechende Rechtsprechung des BGH ist für das Gericht obsolet. Beim BGH handelt es sich um ein von Parteibuch-Richtern der gegenwärtigen Bonner Koalition dominierten Tendenzbetrieb, der als verlängerter Arm der Reichen und Mächtigen allzu oft deren Interessen zielfördernd in seine Erwägungen einstellt und dabei nicht davor zurückschreckt, Grundrechte zu mißachten, wie kassierende Rechtsprechung des BVerfG belegt.
Die Rechtsprechung des 9. Senats des OLG Stuttgart ist der des BGH konform, ja noch »bankenfreundlicher«, sie ist von der (wohl CDU-) Vorsitzenden des Senats bestimmt, die der gesellschaftlichen Schicht der Optimaten angehört (Ehemann Arzt) und deren Rechtsansichten evident dem Muster »das gesellschaftliche Sein bestimmt das Rechtsbewußtsein« folgen. Solche Richterinnen haben für »kleine Leute« und deren, auch psychologische, Lebenswirklichkeiten kein Verständnis, sie sind abgehoben, akademisch sozialblind, in ihrem rechtlichen Denken tendieren sie von vornherein darwinistisch. »Banken« gehören für sie zur Nomenklatura, ehrenwerte Institutionen, denen man nicht sittenwidriges Handeln zuordnen kann, ohne das bestehende Ordnungsgefüge zu tangieren. Und immer noch spukt in den Köpfen der Oberrichter das ursprüngliche BGH-Schema herum, daß nämlich die sog. Privatautonomie als Rechtsinstitut von Verfassungsrang die Anwendung des § 138 BGB auf Fälle vorliegender Art verbiete, obwohl doch § 138 BGB die Vertragsfreiheit verfassungskonform limitiert.« (LG Stuttgart · Urteil vom 12. Juni 1996 · Az. 21 O 519/95, abgedruckt hier)
2.) Noch drastischer urteilte das Landgericht Mannheim, welches gleich alle Vorderpfälzer in einen Topf warf:
»Es handelt sich hier um eine Erscheinung, die speziell für den vorderpfälzischen Raum typisch und häufig ist, allerdings bedarf es spezieller landes– und volkskundlicher Erfahrung, um das zu erkennen – Stammesfremde vermögen das zumeist nur, wenn sie seit längerem in unserer Region heimisch sind. Es sind Menschen von, wie man meinen könnte, heiterer Gemütsart und jovialen Umgangsformen, dabei jedoch mit einer geradezu extremen Antriebsarmut, deren chronischer Unfleiß sich naturgemäß erschwerend auf ihr berufliches Fortkommen auswirkt. Da sie jedoch auf ein gewisses träges Wohlleben nicht verzichten können – sie müßten ja dann hart arbeiten –, versuchen sie sich “durchzuwursteln” und bei jeder Gelegenheit durch irgendwelche Tricks Pekuniäres für sich herauszuschlagen. Wehe jedoch, wenn man ihnen dann etwas streitig machen will! Dann tun sie alles, um das einmal Erlangte nicht wieder herausgeben zu müssen, und scheuen auch nicht davor zurück, notfalls jemanden “in die Pfanne zu hauen”, und dies mit dem freundlichsten Gesicht.« (LG Mannheim, Urteil vom 23.01.1997 – (12) 4 Ns 48/96, abgedruckt in NJW 1997, 1995f)
Da fragt sich mancher, ob die sowas dürfen. Die Antwort ist klar: Natürlich dürfen die das, denn Richter sind nur und ausschließlich dem Gesetz unterworfen. Das hat Konsequenzen in einem Land, das nach dem Verbotsprinzip lebt, wo also gilt, dass alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten wurde. Grenzen setzt den Richtern folglich nur das Strafrecht. Beleidigen oder übel nachreden sollte man auch in einem Urteil nicht und irgendwo droht auch noch die Rechtsbeugung. Da urteilen dann Richter über Rechtsverstöße von Richtern – wahrscheinlich der am wenigsten zur Verurteilung führende Tatbestand des ganzen Rechts.
Da wir uns mittlerweile in der Weihnachtszeit befinden, könnte man sich da mal fragen, ob Richter auch über eine jungfräuliche Geburt entscheiden können. Du magst Dich, geneigter Leser, fragen, weshalb dies denn in unserer modernen Welt eine Rolle spielen sollte. Doch in der Juristerei gibt es nichts, das es nicht gibt. Es geschah nämlich tatsächlich in Hessen vor gut zwei Jahrzehnten, dass eine verheiratete Frau ein Kind gebar und selbstverständlich (= als Zeugin vor Gericht) behauptete, der Kindsvater sei ihr Ehemann. Nachdem dies durch Gutachten widerlegt worden war, fiel ihr ein, dass ein „Herr aus Hamburg“ sie mal geküsst hatte, weshalb sie wohl vom Küssen schwanger geworden sein müsse.
Der zuständigen Staatsanwaltschaft reichte dies für eine Anklage wegen uneidlicher Falschaussage, weshalb letztlich ein Strafrichter darüber zu entscheiden hatte, ob Frauen vom Küssen schwanger werden können. Und tatsächlich erinnerte sich der Amtsrichter an die in der Bibel erwähnte unbefleckte Empfängnis, auf der so wörtlich „immerhin die Kulturgeschichte des christlichen Abendlandes zu einem nicht unerheblichen Teil beruht.“ Er entschied folglich, dass der Frau eine Falschaussage nicht nachgewiesen werden könne und ließ die Anklage nicht zu.
Wer das jetzt verrückt findet, möge darüber nachdenken, was die Alternative wäre. Strafrecht ist eine Waffe und es gibt genügend Länder, in denen Strafrichter Instrument der Politik sind. Eine mit dem Segen der Justiz vorgeflunkerte Jungfrauengeburt ist eine Bagatelle gegen die ungezählten Menschen weltweit, die im Namen einer korrumpierten Gerechtigkeit hinter Gittern verrotten.