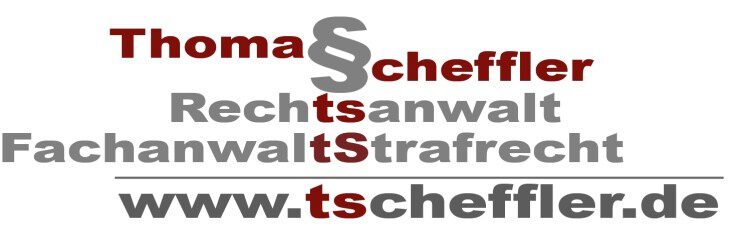Wie funktioniert eigentlich die „Wahrheitsfindung“?
Der überwiegende Teil des Strafprozesses findet in sogenannten Tatsacheninstanzen statt, wo eben Tatsachen festgestellt, also Beweise erhoben werden. zustellen. Zuschauer mögen es dann besonders, wenn Verteidiger „den Zeugen grillen“. Dazu müssen sie allerdings erst einmal warten, bis Gericht und StA den Sachverhalt durch eigene Befragung festgeklopft haben. Ganz am Ende der Fragerunde dürfen sie dann mit viel Aufwand herasuarbeiten, dass der Zeuge sich in manchen Punkten nicht absolut sicher ist, sondern nur etwa zur Hälfte. Als ob das dann noch jemanden interessierte.
Mir fehlt die Geduld für dieses Grillen, ich möchte vorher wissen, was Sache ist. Darum befrage ich Zeugen meistens lange vor dem Gerichtstermin, was bei den Staatsjuristen als anrüchig gilt, aber nicht verboten ist. Warum also nicht? Zudem: Staatsanwaltschaft und Gericht haben die Polizei als Helfer, sie können Zeugen durch die Polizei befragen lassen. Der Verteidiger kann das nicht, zur Durchsetzung der Waffengleichheit muss er es daher selbst tun. Anwaltliche Erhebungen (dazu auch => hier) sind für eine erfolgreiche Verteidigung unerlässlich. Strafverteidigung erwächst aus dem Wissensvorsprung.
Im Strafprozess gibt es Zeugen der Anklage, Zeugen der Verteidigung und neutrale, also zufällig vorbeigekommene Zeugen. Die erste Gruppe mauert, die letzte liefert nur, was schon in der Akte steht. Bleiben die Entlastungszeugen, die ich praktischerweise – Zeit ist Geld – an einem Tisch zusammentrommele. Du wirst, geneigter Leser, kaum glauben, wie kontrovers Aussagen sein können. Meist endet so ein Gespräch mit heftigsten Diskussionen darüber, wer jetzt wann genau was gemacht hat. Weil die Zeugen in einer eher informellen Befragung freier bekunden, sich Zweifel erlauben, andere Aussagen mit der eigenen abgleichen, die Absolutheit eigener Erinnerung freimütig hinterfragen.
In der Hauptverhandlung spulen sie dann nur ihren Text ab, liefern knapp, was Gericht und StA erfragen – mehr nicht. Es sind dann völlig andere Zeugen, eher Marionetten als Menschen. Ich gehe davon aus, dass dies bei den Zeugen der Anklage nicht anders ist.
Die Justiz nennt dies, also das Aufrufen von Zeugen einer nach dem anderen, Wahrheitsfindung, ich erachte es als suboptimal. Denn die Wahrheit erschließt sich nicht durch die Formalien der StPO. Viel effektiver wäre es, alle Zeugen gemeinsam darüber diskutieren zu lassen, was sich zugetragen hat.
Aber dann wäre der dubium pro reo zu offensichtlich.